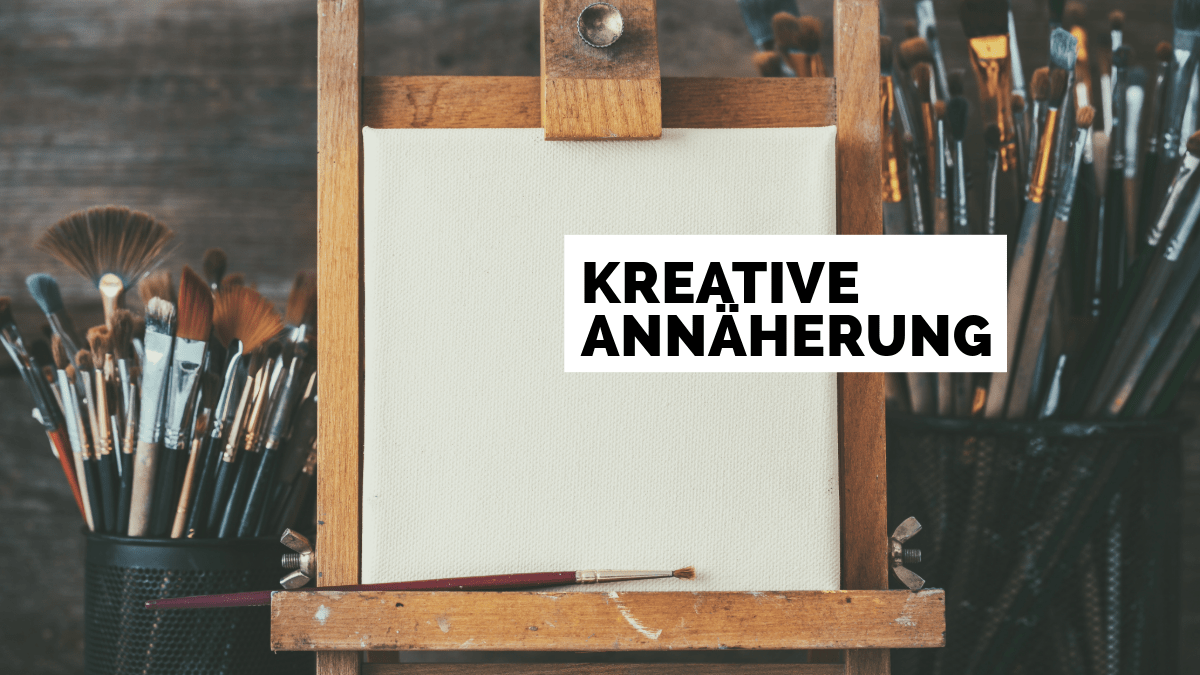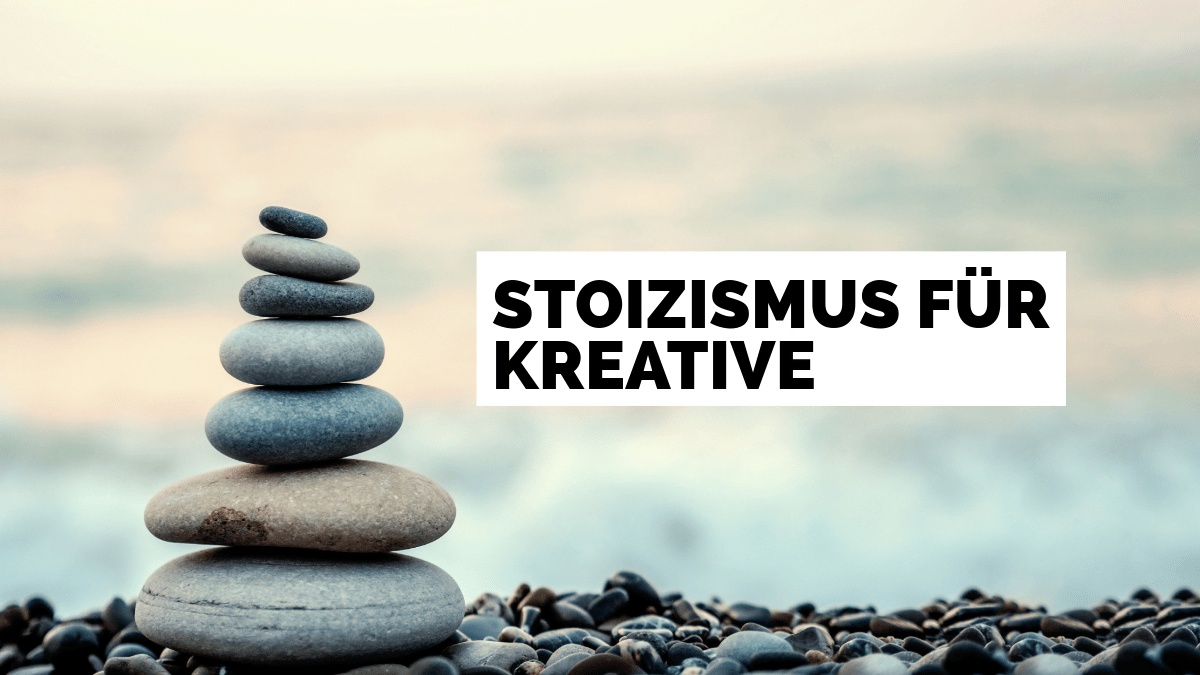Wie erstelle ich besseren Content? Die Frage klingt simpel, ist aber essentiell, wenn man darüber nachdenkt, in irgendeiner Form Content Creator zu werden. Content Creation ist ein dynamisches Feld im Dienstleistungssektor und kann unglaublich viele, spannende Formen annehmen. Allerdings werden Inhalte nur dann wirklich konsumiert, wenn sie einen Mehrwert bieten oder qualitativ hochwertig sind. Der Schlüssel dazu liegt in der wöchentlichen Content-Erstellung.
Privat oder Öffentlich: Der erste Schritt zur Konsistenz
Bevor du dich in die Öffentlichkeit wagst, ist es zunächst wichtig, ein klares Ziel zu haben. Überlege dir, ob dein Content primär privat sein oder öffentlich geteilt werden soll. Für den Anfang ist es sicherlich immer besser, im Privaten zu experimentieren und deine Kreationen mit Freunden und Familie zu teilen. Das gilt für nahezu jede Form von Content – egal, ob es Texte, Fotos, Videos oder Ähnliches ist. Es geht vor allem um die Übung und darum, ein Gefühl für die Erstellung von Inhalten zu entwickeln. Freunde und Familie werden dir auf Nachfrage konstruktive Kritik geben, und du hast einfach weniger Druck von außen. Denn wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, wird selbst bei der besten Leistung immer irgendjemand etwas daran auszusetzen haben. Das liegt leider in der Natur der Kommunikation im pseudo-anonymen Internet.
Bleib konsequent: Warum wöchentlicher Content zählt
Wahrscheinlich ahnst du es jetzt schon, denn jetzt kommt der altbekannte Spruch: Übung macht den Meister! Es geht beim Weg zu besseren Inhalten in Wahrheit nämlich nicht um Perfektion oder den Ort, wo du deine Inhalte teilst, sondern darum, überhaupt etwas zu erschaffen. Und das geht nur mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Es ist sehr wichtig, dass du konsequent konsistent Inhalte erstellst – egal für wen. Dabei sollte dein Fokus sein, wenigstens einmal pro Woche irgendetwas zu schaffen. Sei es ein Tweet, ein Bild, ein kurzes Video. Auch eine Notiz im Tagebuch oder ein Blogbeitrag gehören dazu. Ich kann nur immer wieder DougDougDougs Guide für neue Content Creator empfehlen. Auch hier wird darauf gepocht, konstant Inhalte zu erschaffen und so die wöchentliche Content-Erstellung zu etablieren.
Die ultimative Methode für besseren Content
Konsequent konsistent zu erschaffen ist mit Abstand die beste Methode, um aktiv als Content Creator erfolgreich zu werden. Du wirst über die Dauer nicht nur bessere Inhalte erstellen, sondern kannst dir auch ein gutes Bild davon machen, wie aufwändig der „Job“ als Content Creator ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es gar nicht einfach ist, Ideen zu skizzieren, die auch die Öffentlichkeit interessieren. Ich habe das im letzten Jahr versucht, indem ich wöchentliche Blog-Beiträge und jede zweite Woche YouTube-Inhalte veröffentlicht habe. Es war eine stressige Zeit, aber ich konnte viel über meinen Workflow lernen und natürlich auch über die Plattformdynamiken.
Bei dieser Reise wirst du nicht nur auf kreative Blockaden stoßen, sondern auch auf Organisationsprobleme. Das Gute ist, dass du auch diese Herausforderungen als Content verwerten kannst, wenn du dir deine eigenen Gedanken dazu machst. Das hilft dir nicht nur dabei, deine Inhalte zu verbessern, sondern schärft auch deinen Geist. Und das ist doch eine wunderbare Sache, die durch wöchentliche Content-Erstellung erst möglich wird!